Tonhöhe
Treffen diese Luftdruckschwankungen periodisch an unserem Ohr ein, nehmen wir sie als Schallereignis mit einer bestimmbaren Tonhöhe (Klang) wahr, wobei die Tonhöhe von der Geschwindigkeit abhängt, mit der die einzelnen Phasen aufeinanderfolgen (Frequenz). Treffen dieSchallereignisse ohne erkennbare Regelmäßigkeit beim Ohr ein, empfinden wir ein Geräusch. Es gibt zahllose Zwischenstufen zwischen Klang und Geräusch.Eine Frequenz wird dadurch definiert, wie oft periodische Luftdruckänderungen pro Zeiteinheit beim Ohr eintreffen. Sie wird in Schwingungsphasen pro Sekunde gemessen und in der Maßeinheit "Hertz" (Hz) ausgedrückt. 440 Hz entsprechen der Tonhöhe a'.
Lautstärke
An der senkrechten Achse ist die Stärke der Auslenkung abzulesen (die Feder schwingt hinauf oder herunter). Sie wird physikalisch als Amplitudebezeichnet und macht sich als Lautstärke eines Schallereignisses bemerkbar. Die Messung ist komplizierter als bei der Frequenz, weil sich immer nur Laustärkegrade vergleichen lassen und die Meßgrößen daher relativ sein müssen.Es gibt zwei Arten, Lautstärke
zu messen:
- Der physikalische Schalldruck, also z.B.die
objektive Leistung von Verstärker und Lautsprecher,
wird in Dezibel (db)
ausgedrückt.
- Das subjektive
Lautstärkeempfinden wird in einer Phon-Skala
ausgedrückt.
Frequenzabhängiges Lautstärkeempfinden
In unterschiedlichen Frequenzbereichen hört unser Ohr verschieden gut. Töne mit physikalisch gleicher Lautstärke werden also in verschiedenen Tonhöhen als unterschiedlich laut empfunden.Die Abbildung soll dies verdeutlichen: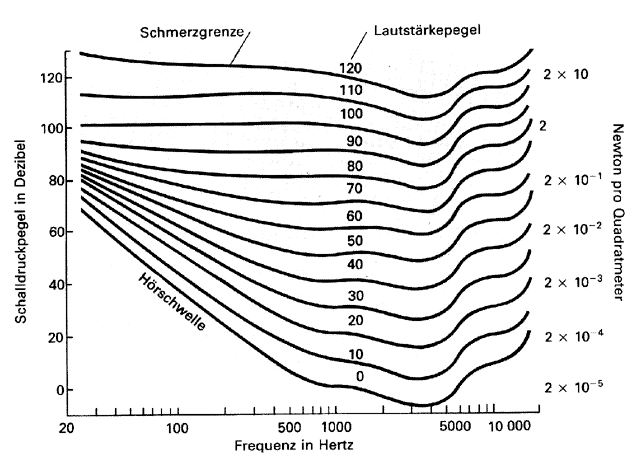
Jeweils eine der gekrümmten Linien stellt das gleiche subjektive Lautstärkeempfinden dar; die senkrechte Achse am linken Rand zeigt den physikalischen Schalldruck. Im mittleren Bereich (um 4000 Hz) stimmen die Werte überein, während links, im Bereich tieferer Frequenzen, mehr Schalldruck aufgewendet werden muß, um die gleiche subjektiv empfundene Lautstärke zu erzielen. Das Ohr hat also im mittleren Bereich die größte Empfindlichkeit.